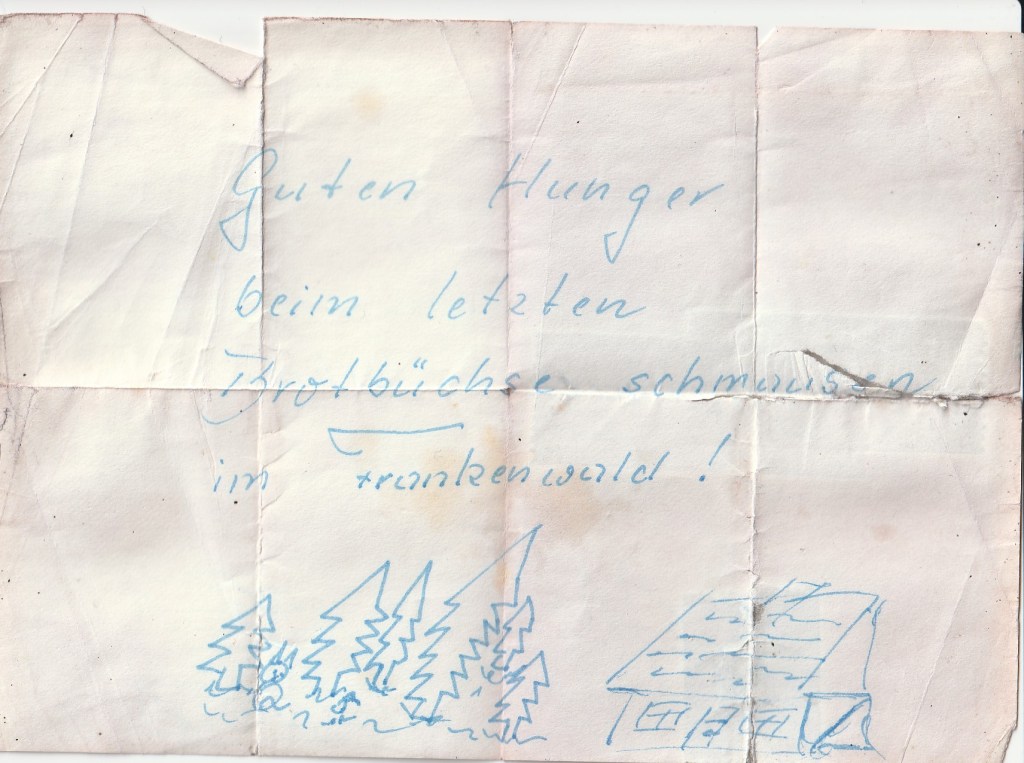„Der Weltraum – unendliche Weiten …“ Wer kennt sie nicht, die ersten Worte des Intros jeder Episode von Star Trek, während derer ein Raumschiff – das Raumschiff – in den Tiefen des schwarzen, nur mit verstreuten Lichtpunkten besetzten Weltraums verschwindet. Als Kind und Jugendlicher war ein Samstag ohne Raumschiff Enterprise kein Samstag. Die Sportschau konnte mir gestohlen bleiben. Aber ohne Commander Kirk, Scotty, Dr. McCoy und Spock ging gar nichts.
Unendliche Weiten.
Zwei Worte, die ich verstehe, deren Bedeutung ich kenne, aber mit denen ich nicht wirklich etwas verbinden kann außer den enigmatischen Abgründen der Handtasche meiner Frau, in denen die Raumzeit aufgehoben scheint. Seltsam nebulös bleiben ansonsten diese Worte, nicht fassbar, irgendwie schwammig. Für einen Sprachfetischisten eine zutiefst unbefriedigende Situation, die es zu ändern gilt.
In meiner Krimskrams-Schublade finde ich einen Golfball mit 4,3 Zentimeter Durchmesser. Ich lege ihn an die Rasenkante unserer Terrasse. Aus dem Küchenschrank hole ich das Glas mit der Hirse und fummle ein Korn heraus. Für einen feinmotorischen Vollhonk eine echte Challenge. Das Hirsekorn, das ich schließlich aus seinem sozialen Umfeld isolieren und auf einer Messerspitze zwischenparken kann, ist deutlich größer als die 0,4 Millimeter, die es haben dürfte, aber etwas Kleineres finde ich nicht. Und es wäre auch schwierig zu handhaben. Das Hirsekorn kommt in einen Eierbecher, und der Eierbecher auf eine der Betonplatten der Terrasse, wo in einer Entfernung von 4,60 Meter vorne an der Rasenkante der Golfball auf seinen Einsatz wartet. Wofür so ein ausziehbares Maßband (Yippie Yippie Yeah!) doch alles gut ist.
In die Verlängerung Golfball – Eierbecher/Hirsekorn komme ich, ebenfalls sozial isoliert, aber dafür mit Gartenstuhl statt Eierbecher. Jetzt habe ich das Ensemble hübsch vor mir. Alec, unser Labrador, der meine Aktion höchst interessiert verfolgt hat, zieht sich übelst enttäuscht zurück auf seine Decke – gibt ja ganz offensichtlich nix zu fressen.
Ich hingegen bin sehr zufrieden: Abgesehen von dem Schönheitsfehler des zu großen Hirsekorns habe ich nun ein maßstabsgetreues Modell Erde (Hirsekorn) – Sonne (Golfball). Das Wort Weite bekommt erste Konturen und Alec ein Leckerli – bei meinen höchst anspruchsvollen astrophysikalischen Versuchsanordnungen kann ich mir Ablenkung durch einen leidenden Hundeblick nicht leisten.
Jetzt ist Google dran. Und Google sagt mir, dass der Stern, der unserem Stern (=Sonne) am nächsten ist, Proxima Centauri heißt. Der kleinste der drei Sterne des Alpha-Centauri-Systems. Entfernung: 1,34 parsec. Mit anderen Worten: 276.395 Astronomische Einheiten (AE). Eine AE ist gleich der mittleren Entfernung der Erde von der Sonne, also 150 Millionen Kilometer. Und ein AE entspricht den 4,60 Metern vom Hirsekorn bis zum Golfball. Nur, dass wir nicht aneinander vorbeireden.
Jetzt bin ich froh, dass ich nur einen Golfball habe. Hätte ich einen zweiten und würde ihn Proxima Centauri taufen, müsste ich mir ein paar Tage Urlaub und einen ordentlichen Mietwagen nehmen: Um dem Hirsekorn-Golfball-Maßstab treu zu bleiben, wäre Golfball II alias Proxima Centauri irgendwo in der Nähe von Madrid zu deponieren, 1.300 Kilometer bzw. 18 Autostunden von meinem Gartenstuhl im nördlichen Rheinland-Pfalz entfernt. Und Mautgebühren müsste ich auch berappen.
Ich schaue auf das zu große Hirsekorn in meinem Eierbecher. Dafür muss ich die Brille aufsetzen, denn auch wenn es zu groß ist, ist es eben doch sehr klein. Weltraum und Eierbecher nehmen sich da nichts: sowohl hier als auch dort ist eben alles relativ. Noch kleiner sind die 8,2 Milliarden menschliche Mikroorganismen, die imaginär auf dem Hirsekorn leben. An dieser Stelle erwäge ich flüchtig die Anschaffung eines Elektronenmikroskops: dann könnte ich auf Bayreuth reinzoomen und vielleicht meine Mutter imaginär am Fenster winken sehen. Sofern Bayreuth nicht gerade auf der beobachterabgewandten Seite des Hirsekorns läge. Da es aber voraussichtlich noch eine Weile dauern wird, bis Elektronenmikroskope für den Hausgebrauch bei den gängigen Discountern verfügbar sein werden, hebe ich vorerst den Kopf und schaue nach Südwesten: Dort, 1.300 Kilometer hinter dem Haus unserer Nachbarn, liegt Madrid. Und dort liegt auch mein virtueller zweiter Golfball, auf dem Proxima Centauri steht. Meine noch verbliebenen Lateinkenntnisse zaubern da ein fettes Grinsen in mein Gesicht: proximus, -a, -um; der nächste. Haha. Der war gut!
So weit, so gut. Oder eben nicht weit. Wir sind schließlich gerade mal bis Madrid gekommen. Beziehungsweise Proxima Centauri. Da hat Lieutenant Sulu auf der Enterprise noch nicht mal den ersten Gang eingelegt. Die Star-Trek-Mannschaft hatte andere Ziele: „Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.“
Oha. Galaxien also. Plural. Das kann ja heiter werden. Bis Madrid musste ich ja schon zweimal tanken.
Google weiß wieder alles und klärt mich auf: „Die Andromeda-Galaxie, unsere nächste große spiralförmige Nachbargalaxie, ist ungefähr 0,765 Megaparsec (das entspricht 765.000 Parsec) entfernt.“ Will sagen: In meinem Golfball-Hirsekorn-Universum wäre die Andromeda-Galaxie 764 Millionen Kilometer weit entfernt. Also einmal bis zur Sonne und dann noch viermal genauso weit. Und da draußen gibt es auch keine Tankstellen mehr, sagt der ADAC. Es sei denn, ich würde mit Wasserstoff fahren und mir den Sprit direkt aus der Sonne abfüllen. Da brauch ich aber einen hohen Lichtschutzfaktor.
Kurzer Orientierungsstop: Ich bin in meinem Modell nun gerade mal von meinem Hirsekorn (Erde) auf der Terrasse über eine Pinkelpause in Madrid (Proxima Centauri) bis zur fünffachen Sonnenentfernung gekommen und damit bis zur allernächsten Galaxie (Andromeda). Es gibt natürlich noch ein paar mehr. Ungefähr 200 Milliarden. Im derzeit beobachtbaren Universum. Und die Entfernungen zwischen ihnen bewegen sich typischerweise so in Größenordnungen von Millionen parsec.
An diesem Punkt:
registriere ich a) einen zunehmenden Respekt vor Commander Kirk und seinen Leuten bzw. den Dimensionen, die die Speisekammer auf der Enterprise gehabt haben muss,
macht sich b) ehrfürchtiges Staunen in mir breit, wenn der Begriff „Nachbar“ in astronomischen Zusammenhängen fällt,
hat c) die Wortkombination Unendliche Weiten einen etwas konkreteren Vorstellungsinhalt bekommen. Denn Kirk & Co. wollten ja zu Galaxien, „die nie zuvor ein Mensch gesehen hat“. Und das im Jahr 2200. Da müssen wir aber Gas geben, wenn wir die Fahrzeugtechnik bis dahin entsprechend aufpimpen wollen. Sonst gehen hinter Madrid sehr schnell die Lichter aus.
Entspannt lehne ich mich in meinem Gartenstuhl zurück und schaue über den Hirsekorn-Eierbecher, den Golfball und das Haus auf der anderen Straßenseite in Richtung Madrid, wo im Mai-Himmel die 1 AE entfernte Sonne strahlt. Nicht nur Alec, auch ich bin der Meinung, dass sich die Aktion gelohnt hat. Ich weiß jetzt, dass unendlich weit tatsächlich echt weit ist.
Und auf diesem Hintergrund ist natürlich auch vollkommen klar, von welch überzeitlicher Bedeutung es ist, ob das 220.000 km² große Kaschmir, das nur unter dem Elektronenmikroskop zu erkennen ist, zu Indien, Pakistan oder China gehört. Oder die Falkland-Inseln zu Großbritannien oder zu Argentinien, das Baskenland zu Spanien, die Ukraine zu Russland und Grönland zu den USA.
Trump, Putin, Xi Jinping und wie sie alle heißen sollten einfach öfter mal Hirsebrei essen.
Gefällt mir Wird geladen …